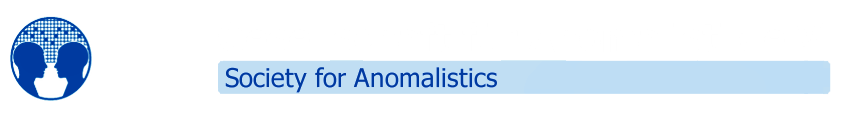Nahtoderfahrungen (NDEs) haben als Forschungsgegenstand eine erstaunliche Themenkarriere während der letzten Dezennien durchgemacht. Dabei standen für lange Zeit positiv getönte Beschreibungen und Konzeptionen solcher Erfahrungen im Vordergrund, sowohl was das Erleben selbst als auch dessen Nachwirkungen auf das Leben der Betroffenen anbelangt. Ein Grund dafür ist sicherlich die Tatsache, dass leidvoll erlebte Erfahrungen und Aspekte deutlich seltener vorkommen oder zumindest seltener berichtet werden. Die hier als Studie des Monats vorgestellte Untersuchung von Melloul et al. beschäftigt sich speziell mit Berichten von negativ erlebten NDEs. Mit einem qualitativen Forschungsansatz analysierten sie acht Berichte aus einem großen Datenpool der International Association for Near-Death Studies (IANDS), die den Auswahlkriterien entsprachen und eine hinreichend dichte Beschreibung aufwiesen.
Die interpretativ-phänomenologische Analyse ergab drei übergeordnete Themen und zugeordneten Ober- und Unterthemen. Zwei Befunde erscheinen mir besonders wichtig bzw. interessant. (1) Es ist aus verschiedenen Gründen erheblich schwieriger, über eine negativ-getönte NDE zu reden als über eine positiv erlebte NDE, was zu einer Unterschätzung der Zahl leidvoll erfahrener NDEs führen könnte. Sie werden schlicht und einfach seltener mitgeteilt. Diese Studie könnte einen wichtigen Beitrag liefern, indem sie solchen Betroffenen eine Stimme leiht. (2) Die Autor:innen vermuten einen Zusammenhang von negativen NDEs mit der Persönlichkeitseigenschaft internaler vs. externaler Kontrolle. Die Frage also, wie jemand mit Situationen des Kontrollverlusts umgehen kann, könnten einen signifikanten Einfluss auf die Erlebensqualität der NDE haben. Dies erinnert an Befunde aus einer eigenen Studie zur Schlafparalyse (SP), bei der die Situation insofern umgekehrt ist, als die Mehrzahl der Berichte negativ getönt ist, aber es doch auch positiv erlebte SP-Erfahrungen gibt von Personen, die die körperliche Lähmungserfahrungen nicht mehr mit den Emotionen von Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit erleben, sondern den Zustand als „Sprungbrett“ für außergewöhnliche Zustände wie außerkörperliche Erfahrungen nutzen.