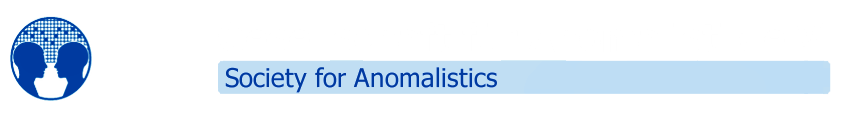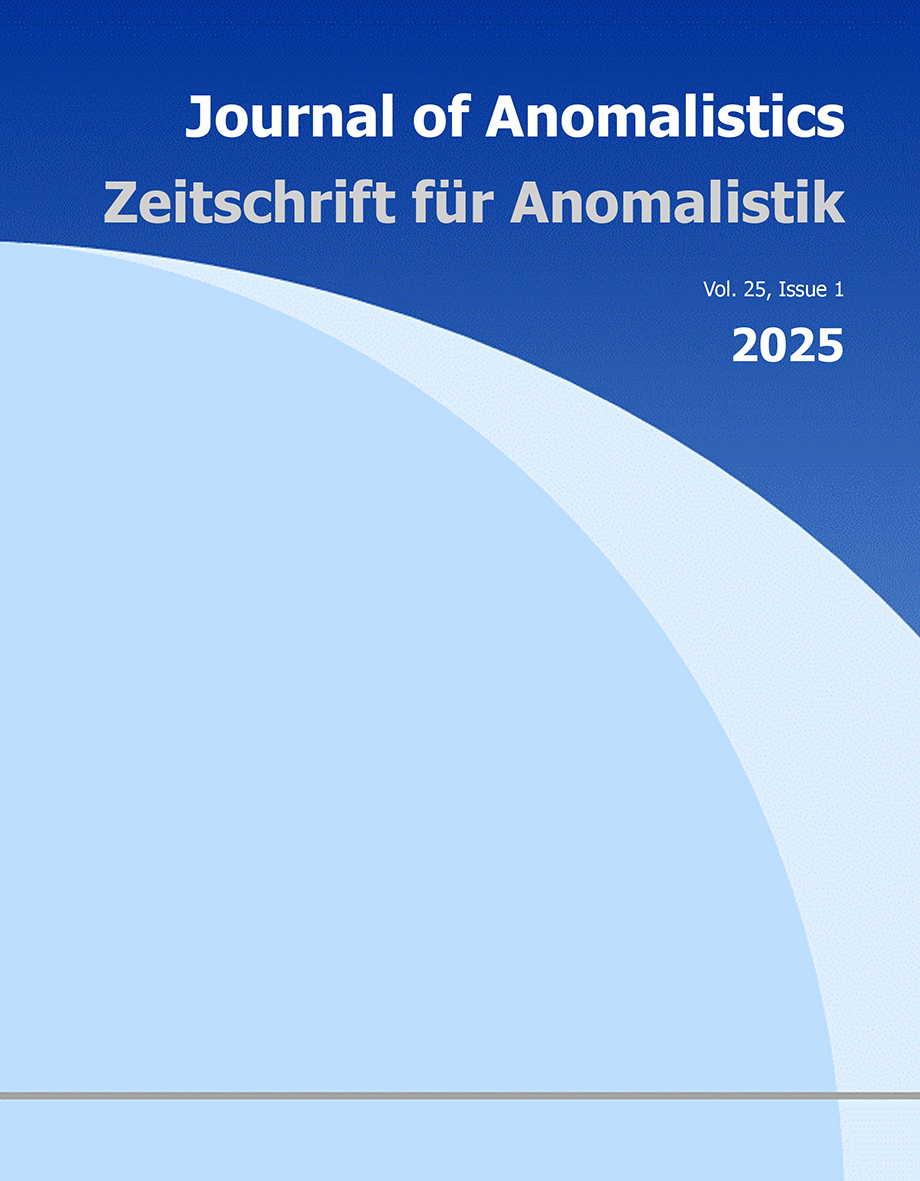DOI: 10.23793/zfa.2025.COMP1
![]() Zeitschrift für Anomalistik 25-1 als PDF (4,1 MB)
Zeitschrift für Anomalistik 25-1 als PDF (4,1 MB)
![]() Zeitschrift für Anomalistik 25-1 als PDF (komprimiert, 2,4 MB)
Zeitschrift für Anomalistik 25-1 als PDF (komprimiert, 2,4 MB)
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 5–14
DOI: 10.23793/zfa.2025.005
Editorial
Parapsychology – an “Ultra-Soft Science?”
Parapsychologie – eine „Ultra-Soft Science“?
![]() Artikel im Volltext als PDF (englisch, S. 5–10)
Artikel im Volltext als PDF (englisch, S. 5–10)
![]() Artikel im Volltext als PDF (deutsch, S. 10–14)
Artikel im Volltext als PDF (deutsch, S. 10–14)
Hauptbeiträge
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 15–60
DOI: 10.23793/zfa.2025.015
Macroscopic Complementary Relation Between Subjective Observations and Objective Measurements of Colors
Markus A. Maier, Moritz C. Dechamps
![]() Englischsprachiger Artikel im Volltext als PDF
Englischsprachiger Artikel im Volltext als PDF
Zusammenfassung
In der Verallgemeinerten Quantentheorie (GQT), einer Theorie zur Beschreibung psychophysischer Phänomene, werden subjektive und objektive Aspekte der Realität als komplementär betrachtet. Die hier vorgestellte Forschung hatte das Ziel, eine solche makroskopische Komplementarität zwischen subjektiven und objektiven Realbeschreibungen im Kontext der Farbbeurteilung zu untersuchen. Insbesondere stellt die Nicht-Kommutativitätsannahme der GQT die These auf, dass zwei Observablen, die aus den subjektiven und objektiven Teilsystemen stammen, nicht gleichzeitig spezifische Eigenwerte liefern. Vielmehr verändert der Messakt innerhalb eines Teilsystems, z. B. die Durchführung objektiver Messungen an einem Stimulus, den Zustand des gesamten Systems, einschließlich der Eigenwerte des anderen Teilsystems, z. B. des subjektiven Erlebens dieses Stimulus. Diese Vermutung wurde empirisch in vier Studien und in drei Gesamtanalysen des vollständigen Datensatzes über alle vier Studien getestet. Die experimentelle Manipulation beinhaltete eine Messvariation eines Aspekts des vermeintlichen komplementären Paares, nämlich die Speicherung (Nicht-Löschungsbedingung) oder Löschung (Löschungsbedingung) objektiver Farbparameter (Farbton und Helligkeit). Es wurde erwartet, dass die Löschungsmanipulation den anderen Teil des Paares beeinflussen würde, nämlich die subjektiven Bewertungen der Farbe in Bezug auf Helligkeit und Gefallen. Die primäre Hypothese, die löschungsabhängige Effekte auf Variationen der subjektiven Helligkeitswerte testete, wurde in den Studien 1 und 2 bestätigt, konnte jedoch in den Studien 3 und 4 nicht repliziert werden. Die anfänglichen Ergebnisse, die mit dieser abhängigen Variablen gewonnen wurden, können daher als False-Positives gewertet werden, und die primäre Hypothese konnte nicht bestätigt werden. Die zweite Hypothese, die Löschungseffekte auf die mittleren Werte des subjektiven Gefallens testete, ergab folgende Ergebnisse: Die explorativen Erkenntnisse aus den Studien 1 und 2 sowie die bestätigenden Ergebnisse aus Studie 3 und der präregistrierten Studie 4 zeigten einen Löschungseffekt auf das subjektive Gefallen, wobei in jeder Studie höhere Gefallenswerte in der Nicht-Löschungsbedingung im Vergleich zur Löschungsbedingung beobachtet wurden. Da das experimentelle Design absichtlich durch eine alternative „Farbverzerrung“ kontaminiert wurde, um die Effektdokumentation zu stabilisieren, können keine eindeutigen kausalen Löschungseffekte auf Einzelstudienebene nachgewiesen werden. Um diese Kontamination zu überwinden, wurde eine Gesamtanalyse-Strategie vorab geplant und an dem kombinierten Datensatz durchgeführt. Mehrere Gesamtanalysen schlossen die alternative Erklärung der „Farbverzerrung“ und eine weitere Störvariable aus. Zusammenfassend lieferten die Gesamtergebnisse Belege für einen Löschungseffekt auf das subjektive Gefallen, die das Modell der GQT stützen. Dies kann als makroskopische komplementäre Beziehungen zwischen objektiven und subjektiven Realbeschreibungen interpretiert werden, wie sie von der GQT vorgeschlagen werden. Die Implikationen dieser Ergebnisse für unser Verständnis der Natur der Realität und für die Gültigkeit der GQT werden diskutiert.
Schlüsselbegriffe
Generalisierte Quantentheorie, makroskopische Komplementarität, makroskopische non-lokale Verschränkungskorrelation, psychophysische Interaktion, subjektiv-objektive Dualität
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 61–118
DOI: 10.23793/zfa.2025.061
Magic Flights or Mind’s Eye? Further Explorations of Dimensional-Slip Narratives
James Houran, Debra Lynne Katz, Jessica Williamson, Stanley A. Koren, Helané Wahbeh, Marjorie H. Woollacott
![]() Englischsprachiger Artikel im Volltext als PDF
Englischsprachiger Artikel im Volltext als PDF
Zusammenfassung
Diese Fallstudie untersucht das Phänomen der Dimensionssprünge, d. h. anomale Verzerrungen oder Wahrnehmungen von Raum und Zeit, die transzendentale Inhalte oder Themen beinhalten können. Unsere Untersuchung konzentriert sich insbesondere auf „Nell“, einer besonders stark „heimgesuchte“ Frau, die vier Erfahrungen dokumentierte, in denen sie sich physisch in andere Welten versetzt fühlte. Unter Verwendung eines Mixed-Methods-Ansatzes haben wir KI-gestützte Inhaltsanalysen mit sekundären Bewertungen durch Fachexperten durchgeführt, um Nells Erfahrungen anhand konkurrierender theoretischer Ansätze zu bewerten. Mithilfe einer thematischen KI-Kodierung wurden ihre Erzählungen mit bekannten Merkmalen von Kundalini-Erwachen, medialen Phänomenen, Bilokationserfahrungen und von elektromagnetischen Feldern (EMF) induzierten Wahrnehmungsverzerrungen verglichen. Die Ergebnisse zeigten eine starke Übereinstimmung mit EMF-bezogenen Aktivitäten und, bis zu einem gewissen Grad, mit Bilokationsphänomenen im Vergleich zu den anderen hier untersuchten Hypothesen. Nachträgliche Berichte über verschiedene Dimensionsverschiebungen, die von Nell's Familienmitgliedern in derselben geografischen Umgebung erlebt wurden, deuteten weiter auf den wahrscheinlichen Einfluss von Umweltvariablen oder Verhaltensansteckung hin. Die Studie stellt ein Kontinuumsmodell der Bilokation vor, das Perspektiven aus Psychologie, Neurowissenschaften und Parapsychologie integriert, um anomale Wahrnehmungen von Raum und Zeit zu konzeptualisieren. Es gab keine schlüssigen Beweise dafür, dass Nell sich physisch irgendwohin bewegt hat, sodass unsere Ergebnisse wohl auf das Zusammenspiel zwischen Grenzverschiebungen, veränderten Bewusstseinszuständen und Umweltfaktoren in ihren anomalen Wahrnehmungen hindeuten. Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit weiterer multidisziplinärer Untersuchungen zu Berichten über Dimensionsverschiebungen und deren Implikationen für die Bewusstseinsforschung. Zukünftige Forschungen sollten daher kontrollierte Experimente und breitere Fallstudien einbeziehen, um theoretische Modelle dieser außergewöhnlichen Erfahrungen zu verfeinern.
Schlüsselbegriffe
Begegnungserfahrungen, Haunted-People-Syndrom, Liminalität, narrative Realität, Psi, Raumzeit
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 119–151
DOI: 10.23793/zfa.2025.119
Transterrestrische Scham. Zur Konstruktion fiktionaler Alien-Bilder in Klassikern der englischsprachigen Science-Fiction-Literatur im 20. Jahrhundert
Noah Sproß, Andreas Anton
Zusammenfassung
Die Arbeit analysiert klassische Werke der englischsprachigen Science-Fiction-Literatur des 20. Jahrhunderts im Hinblick auf die fiktionale Konstruktion außerirdischer Wesen. Im Zentrum steht die These, dass Darstellungen von Aliens im Wesentlichen als Spiegelbilder gesellschaftlicher Diskurse, kollektiver Emotionen und Selbstbeschreibungen zu betrachten sind. Mittels einer vergleichenden, hermeneutisch fundierten Analyse ausgewählter Romane – u. a. von H. G. Wells, H. P. Lovecraft, Arthur C. Clarke und Carl Sagan – untersucht die Studie, wie gesellschaftliche Ängste, Hoffnungen und kulturelle Paradigmen die künstlerische Konstruktion fiktionaler außerirdischer Entitäten prägen. Die Analyse erfolgt aus literatursoziologischer, emotionssoziologischer und exosoziologischer Perspektive und unterscheidet die Alien-Darstellungen in drei Grundtypen: feindliche Eroberer, überlegene Wesen und wohlwollende Führer. Dabei zeigt sich, dass außerirdische Figuren als Projektionsflächen transterrestrischer Scham fungieren – eines Gefühls der Unzulänglichkeit angesichts überlegener fremder Intelligenzen. Diese Scham reflektiert nicht nur Identitätskrisen und Verlustängste, sondern auch den Wunsch nach Transformation, Verbesserung und spiritueller Erweiterung. Die literarischen Aliens erscheinen so als narrative Werkzeuge zur Auseinandersetzung mit menschlichen Begrenzungen im biologischen, sozialen, technologischen und existenziellen Sinne.
Schlüsselbegriffe
Science-Fiction-Literatur, Außerirdische/Alien-Darstellungen, transterrestrische Scham, Literatursoziologie, Exosoziologie
Rezensionen
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 152–155
DOI: 10.23793/zfa.2025.152
Lance Storm (2025). A New Approach to Psi
Rezensiert von: Marc Wittmann
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 156–159
DOI: 10.23793/zfa.2025.156
Renaud Evrard (2024). Expériences de Mort Imminente
Rezensiert von: Marc Wittmann
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 160–163
DOI: 10.23793/zfa.2025.160
Elisabeth J. C. Warwood (2025). Behind the Medium’s Mask: Eileen Garrett’s Shadow Self
Rezensiert von: Renaud Evrard
![]() Englische Rezension im Volltext als PDF
Englische Rezension im Volltext als PDF
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 164–166
DOI: 10.23793/zfa.2025.164
Chris Aubeck (Hrsg.) (2024). Letters of the Damned. The Forgotten Investigations of Charles Fort
Rezensiert von: Ulrich Magin
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 167–169
DOI: 10.23793/zfa.2025.167
Peter Kauert & Ulrich Magin (2022). Spuk-Orte in der Pfalz. Von Irrlichtern, Geisterhunden und Weißen Frauen
Rezensiert von: Uwe Schellinger
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 170–176
DOI: 10.23793/zfa.2025.170
Francesco Piraino, Marco Pasi & Egil Asprem (Hrsg.) (2023). Religious Dimensions of Conspiracy Theories. Comparing and Connecting Old and New Trends and Spells
Rezensiert von: Meret Fehlmann
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 177–184
DOI: 10.23793/zfa.2025.177
Volker Lechler (2025). Sterne, Menschen, Politik. Die astrologische Bewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Rezensiert von: Gerhard Mayer
Zeitschrift für Anomalistik 25 (2025), Nr. 1, S. 185–194
DOI: 10.23793/zfa.2025.185
Abstracts-Dienst / Literaturspiegel
Frauke Schmitz-Gropengießer, Gerhard Mayer